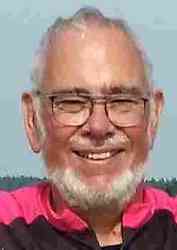Der MännerWege Fragebogen – beantwortet von Thomas Scheskat, Göttingen

Interview und Redaktion: Alexander Bentheim
Fotos: stefan m., photocase.de | privat
Thomas, was war dein persönlicher, biografischer Zugang zu Jungen-, Männer- und Väterthemen? Und was dein politisch-thematischer?
Ich würde meine Antwort in drei Ebenen differenzieren, auch wenn sie alle eng miteinander zusammenhängen. Persönlich sind für mich Unterlegenheitserfahrungen als Junge wichtig gewesen, in Ringkämpfen oder Prügelauseinandersetzungen wusste ich mich nicht durchzusetzen, hatte davor auch immer Angst. Gleichaltrige oder auch Ältere habe ich oft als gemein und unfair erlebt, weil es um Herausforderungen und Angriffe ging, um Dominanz und Einschüchterung, was die Angreifenden wie als Beweis für ihre Stärke benutzt haben. Das hat mich geängstigt; erst später habe ich mir über diesen Zusammenhang viele Gedanken gemacht. Mit Angreifenden und um Überlegenheit Bemühten wollte ich mich also nie identifizieren, und das hatte auch viel mit meiner Familienerziehung zu tun, wo es eher um Fairness oder korrektes Benehmen ging, was ja grundsätzlich gut ist – nur auch mit der Schattenseite, zu brav zu sein und nicht wirklich Strategien gelernt zu haben, wie man sich trotzdem verteidigen und durchsetzen kann.
In diesen persönlichen Bereich gehören in der zweiten Ebene auch die Erfahrungen mit Freundinnen, die unter ihrem Frau-Sein irgendwie mehr leiden mussten als ich unter meinem Junge-Sein beziehungsweise Mann-Werden. Das ging los mit solchen »Phänomen« wie deren Periode oder Benachteiligungen in der Schule, wenn es etwa hieß, Mädchen seien halt nicht so gut in Mathematik. Das ist mir immer schmerzlich aufgefallen. Trotzdem wurde ich als Junge sozialisiert, das heißt, auch »reingeknetet« in dieses subjektive Gefühl, als Mann »natürlicherweise« irgendwie überlegen oder privilegiert zu sein. Im späteren Alter waren dann meine Freundinnen frauenbewegt-feministisch unterwegs, und ich bekam aus deren Umfeld ziemlich Gegenwind. Also Kritik und zum Teil auch Hohn und Spott für alles, was als mackerhaft oder, wie wir heute sagen würden, »toxisch männlich« empfunden wurde. So entstanden meine Motive, mich zu ändern, gerne anders sein zu wollen, so dass ich diesen Frauen gefalle oder sie mich mindestens akzeptieren; das war allerdings oft auch vergeblich. Aber es hatte einen Antrieb gesetzt, mich nach neuen Identifizierungsmöglichkeiten umzuschauen. Und die fand ich dann in Männergruppen durch die Begegnung mit Männern, die ebensolche Veränderungswünsche hatten.
Auf der dritten Ebene, die ich die größere politische-historische Wetterlage nennen würde, waren diverse Kriegsgeschichten sehr bedeutsam – mein Großvater, der im 2. Weltkrieg in Russland umgekommen war, mein Vater, der als Jugendlicher bei der FlaK dienen musste, dort lebensgefährlich unterwegs war und auch Klassenkameraden sterben sah. Dann seine eigene Jungmann-Geschichte, wie er sich aus diesen Kriegswirren rausbewegt und ins neue westdeutsche Nachkriegsleben hineingefunden hat. All das hat mich mitgeprägt, hatte einerseits Vorbildcharakter, enthielt aber auch Aspekte von einem negativem Vorbild, von dem ich mich abgrenzen wollte. Den 2. Weltkrieg habe ich grundsätzlich als Katastrophe erzählt bekommen, die sich nicht wiederholen möge. Dann folgten Konflikte, die ich schon mit dem eigenen Verstand wahrnehmen konnte, wie etwa der Vietnamkrieg. Und letztlich bin ich zu einer pazifistischen Einstellung gelangt, allerdings nicht im klassischen Sinne – weil ich entschieden hatte, ich könnte mich nicht auf eine radikalpazifistische »Seeleninsel« retten und anderen, ginge es um eine Landesverteidigung, die gewissensbelastende Drecksarbeit überlassen. Heute nenne ich pazifistisch, was sich auf die Ablehnung jeglichen Angriffskrieges beziehen würde, aber davon trennen würde ich eine Bereitschaft zur Verteidigung. Was mich noch geprägt hat, war die Ablehnung von Aufopferungswillen für eine vermeintlich größere Sache, so wie mein Großvater für seine Heimatliebe – die er besaß, ohne Nazi zu sein, und trotzdem freiwillig mit in den Krieg zog. Mein Vater wiederholte dies dann vom Muster her, als er in der Wirtschaft durchstartete und bei seinem Aufstieg seine Gesundheit opferte.
Welche waren damals und sind heute deine zentralen Themen in der Beschäftigung mit Jungen, Männern, Vätern? Wie hat sich dein Engagement entwickelt, ggf. verändert?
Als zentral sehe ich meine Erlebnisse und Wahrnehmungen von allem, was ich »Konfliktunfähigkeit« nennen würde und was mit Kommunikationsunfähigkeit zu tun hat – also mit eigenen Gefühlsspannungen eben nicht umzugehen, und wie so auch Gewalt entsteht. Ich hatte, wie schon erwähnt, eigene Erlebnisse als Kind, also wusste ich, wie sich das anfühlt, Opfer von Bedrohung oder Schlägen zu sein. Ich konnte mich von daher immer gut in Frauen hineinversetzen, die in typische Gewaltverhältnisse zu Männern geraten – typisch verstanden sowohl als die private, häusliche Familiengewalt, als auch das Bedrohtsein durch anonyme Gewalt auf der Straße oder, wie uns heute wieder deutlicher vor Augen geführt wird, im Krieg. Gewaltverhältnisse waren für mich immer zentral für die Geschlechterfragen, auch weil ich einmal erleben musste, wie eine mir nahestehende Frau Opfer einer Vergewaltigung wurde, mit Folgen, die man sich daraus nicht wünscht.
Dadurch faszinierten mich Ansätze dazu, wie mit diesen Unfähigkeiten verändernd umgegangen werden könnte. Ich habe in meinem Buch über Aggression ein Erlebnis geschildert, wie eine Rockerbande ein Schulfest an meiner Schule überfiel, ich dort einen Angriff auf einen Mitschüler mit ansah, ich den Täter der Polizei zeigte und dann später von dieser Rockerbande bedroht wurde. Warum ich diese Gewalterfahrung hier erwähne: Weil ich später durch einen Zufall wieder einigen von denen gegenübertrat, als ein Vikar einer Kirchengemeinde, der bei uns in der Schule auch Religion unterrichtete, eine Begegnung von uns Gymnasialschülern mit sozialen Randgruppen organisierte. Und so trat ich zufällig wieder einigen aus dieser Bande gegenüber, die wahrscheinlich im Rahmen des Jugendstrafvollzugs eine soziale Maßnahme abolvierten. So erfuhr ich etwas über deren Familiengeschichten und es dämmerte mir, dass nichts von nichts kommt und Gewalt Wurzeln und Ursachen hat. Diese Verständigung darüber mit den ehemaligen Tätern, die mich zuvor bedroht hatten, war schlüsselhaft für meine spätere Laufbahn als Männerarbeiter und in der Psychotherapie.
Als meine persönliche Strategie habe ich die Körperpsychotherapie entdeckt und festgestellt, dass sie nach wie vor die wirksamste Methode ist, mit Menschen an Veränderungen zu arbeiten, d.h. sie zu Selbsterkenntnis und auch zur Lust an Selbstentwicklung anzuregen. All das braucht man, um zum Beispiel Gewalttäter dafür zu gewinnen, ihre Gewaltneigungen verändern zu wollen. Dies habe ich seit nunmehr 22 Jahren im Rahmen einer psychiatrischen Klinik mit Straftätern direkt erproben und weiter ausgestalten können.
Darüber hinaus engagierte ich mich im Verein »Woge – Wege ohne Gewalt«, eine Einrichtung zum Verantwortungstraining gegen häusliche Gewalt, die ich mitgegründet und deren Arbeit ich mit entwickelt habe. Häusliche Gewalttäter bekommen hier die Chance, durch ein Training von Strafverfolgung befreit zu werden. Dabei geht es auch um männliche Identität: womit identifizieren sich Männer? Was prägt ihr Selbstverständnis? Und wie entsteht daraus Schaden, körperlich und seelisch für sich selbst, und auch für ihre Beziehungen? Wenn diese Identifizierung bei jemandem sehr eng ist und er vieles andere – etwa das vermeintlich Weibliche und Kindliche – aus dem Menschsein ausklammert, nennt er dann das, was überbleibt, das Männliche. Dafür verwende ich die Formel: Was man traditionell den ganzen Mann nennt, ist höchstens ein halber Mensch. Es entsteht so die Frage: Will ich ein »ganzer Mann« sein oder will ich ein ganzer Mensch sein? Dies sind Widersprüche, die man fruchtbar aufgreifen und bis zu der Frage führen kann: Wer will ich sein, was in mir will ich zum Wachsen bringen, und wofür bin ich auch bereit einzustehen? Wenn dies mir die »Entwertung« einträgt, dann angeblich kein richtiger Mann zu sein, kann ich das dann mit Selbstvertrauen und neuer Stärke behaupten? Dazu haben für mich die Milieus beigetragen, in denen ich mich bewegt habe, früher studentisch, dann wie auch immer linksgrünliberal, wo man sich auch in seinen Blasen verkriechen kann. Zum Ausgleich habe ich mit den real existierenden Männermilieus dennoch reichlich Kontakt gehabt: im Handballverein, bei der Bundeswehr, bei der Waldarbeit (weil ich auch mal Forstwissenschaft studiert habe), und zuletzt während der Jahre mit psychisch kranken Straftätern. Das alles mündet für mich in die neuzeitliche Kategorisierung von »toxischer Männlichkeit«. Ich halte sehr viel von dieser Begriffsidee, wobei ich aber auch davor warne, sie zu leichtfertig zu verwenden. Es muss gut erklärt werden, weil selbstverständlich nicht Männer an sich toxisch sind, sondern deren Männlichkeitsstereotypen. So kam ich dazu, Arbeitsideen zu entwickeln, die man vielleicht »Strategien der Entgiftung« nennen könnte, die Entgiftung von Aggression. Für mich ist dies schlüsselhaft, um an sich zu arbeiten – wenn man die Aggression weiterfasst und nicht nur als den feindseligen Angriff begreift, sondern als alles, was mit einer Handlungsenergie »angefasst« wird, um es zu verändern oder zu beeinflussen. So wie es im Wortsinn des alten »aggredi« schlicht bedeutet: herangehen, nach vorne gehen. Und das, was wir klassischerweise als Aggression bezeichnen, das nennen wir in der Arbeit dann »vergiftete Aggression«, wenn es eben sich selbst, andere oder unsere Beziehungen beschädigt. Davor bleibt aber: jede Menge Zumutung, auch der Mut, sich anderen mit seinen berechtigten Anliegen und Positionierungen zuzumuten, und zugleich eine gute Abgrenzung zur Gewalt zu entwickeln. Das ist mein zentrales Arbeitsthema, verbunden mit der Idee, dass sich so auch »toxische Männlichkeit« mit Selbsterfahrungsstrategien entgiften lässt. In diesen skizzierten Schritten – Selbsterfahrung, Körperpsychotherapie, Männerarbeit, Aggressionsarbeit – stecken auch die Veränderungschancen in meiner Herangehensweise: Menschen, die mit ihrer Handlungsenergie und Kraft konfrontiert werden, können sich klar machen, was sie damit erwirken oder anrichten. Die meisten finden das spannend und sind, wenn sie durch dieses Themenportal der Aggression gehen, auf einmal wundersam bereit, sich mit viel mehr noch auseinanderzusetzen, eben weil sie auf einmal die Arbeit an sich selbst entdecken und Lust darauf bekommen.
Eine spannende Erweiterung der Aggressionsarbeit ergab sich auch in der Begegnungsarbeit zwischen Männern und Frauen: sich insbesondere über das Thema Aggression mit den diversen Positionen in der Gesellschaft und den verschiedenen psychischen Prägungen durch Geschlechterbilder auseinanderzusetzen – um dann in den Dialog und wieder zueinander zu finden.
Meinen Weg über die Stationen »Männerbüro Göttingen« (1986) und dann die Entwicklung der Männerjahresgruppen mit dem Konzept »Mannsein – eine einjährige Forschungsreise«, die ich fast 30 Jahre lang an verschiedenen Orten mit 400-500 Männern durchgeführt habe, möchte ich nicht missen; ich sehe immer noch mit großer Befriedigung, was ich hierbei mit anderen Männern teilen konnte.
Für dich nachhaltige gesellschaftliche oder historische Ereignisse – auch im Kontext deiner Arbeit?
Früh schon, noch als Kind, hat mich der Holocaust extrem berührt, ich erinnere meine Fassungslosigkeit, als Anfang der 1960er Jahre die ersten Auschwitzprozesse begannen, und »SPIEGEL«-Serien darüber mit Fotos von KZ-Szenen, Leichenbergen und vielem mehr erschienen. Das hat mich vollkommen fassungslos gemacht, aber auch einen schnellen Einblick in die Realitäten dieser Welt gegeben. Später hatte ich viele Begegnungen in und mit der DDR, weil ich dort eine Liebesbeziehung hatte und mit dieser Frau in der DDR meinen Sohn bekam. Das »Ereignis DDR« – als Kriegsfolge mit der Spaltung Deutschlands, mit so vielen Dramen und Inkonsequenzen auf allen Seiten – historische Trennlinien, die auch quer durch unsere Familie gingen, Beziehungen über Grenzen zu haben, zu halten und auch wieder scheitern zu sehen, das hat mich auch geprägt. Und wie schon erwähnt: Pazifismus als die Ablehnung von Angriffskriegen, und Feminismus als großes Feld des Kampfes von Frauen um Gleichberechtigung mit allen Erfolgen und auch Irrtümern und Irrwegen, das fand ich für mich extrem nachhaltig.
Für den Kontext meiner Arbeit sind die erwähnten persönlichen Erfahrungen ebenso wichtig, der Überfall der Rockerbande und die spätere Begegnung mit denen als Art »schicksalhaftem Geschenk«. Bedeutsam waren meine Ambivalenz beim Wehrdienst aus Gewissensgründen wegen der nicht zu delegierenden Kriegsdrecksarbeit an andere, aber auch die entwürdigenden Erfahrung beim Wehrdienst selbst, sodass ich nach dem Wehrdienst dann noch den Kriegsdienst verweigerte. Die genannten Gewalterfahrungen gegen Freundinnen oder Frauen, die ich kannte, waren ebenso prägend wie die Erfahrungen während der Körperpsychotherapie-Ausbildung, die viele tiefe, innere Einblicke in die eigene Seele, auch Selbstkritik, ermöglicht haben. Dazu zählten auch die Erfahrung mit Kampfübungen, Boxen und Ringen hauptsächlich, aber auch Tai-Chi als »tänzerische Kampfdisziplin«, und wie man sie benutzen kann, um daraus eine gesunde Selbstbehauptung unter Einbeziehung des Rechts des Gegenübers machen zu können. Dies einschließlich einer guten Eigenpositionierung, die einen nicht wehrlos macht, aber bei der man auch nicht zum toxischen Angreifer wird. Und nicht zuletzt alles, was ich als Vater erlebt habe, vom Miterleben zweier Geburten mit allen Dramen und Freuden, Kleinkindfürsorge, enge Verbundenheit, Symbiose, Gefühle, und Auseinandersetzung mit einem pubertierenden Jugendlichen, aus der die Notwendigkeit entstand, aus Liebe zum Kind auch Autorität zu bilden und auszuüben, was eine Menge Zumutung für beide Seiten beinhaltete. All das in gesellschaftlicher und persönlicher Wechselbeziehung waren wichtige Elemente für meine Arbeit. – (eine Fortsetzung des Interviews folgt in Kürze)

:: Thomas Scheskat, Pädagoge M.A., absolvierte eine körperpsychotherapeutische Ausbildung sowie Weiterbildungen in Tiefenpsychologie, Psychotherapie mit Sexualstraftätern und Dialektisch-Behavioraler Therapie (DBT/IBT). Er gründete 1986 das Männerbüro Göttingen und 1997 das Göttinger Institut für Männerbildung mit. Seit 35 Jahren arbeitet er freiberuflich mit körperorientierten Verfahren in Männer- und gemischtgeschlechtlichen Gruppen, in Einzel- und Paararbeit sowie in Beratung und Coaching. Seit 2002 ist er als Stations- und Gruppenleiter im psychologischen Dienst der forensisch-psychiatrischen Landesklinik Moringen in Niedersachsen tätig. Er war Mitgründer und Vorstand der Beratungsstelle Wege ohne Gewalt e.V. Göttingen – Verantwortungstraining für Täter:innen häuslicher Gewalt.