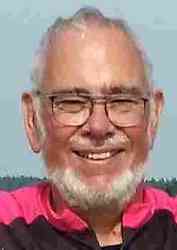Der MännerWege Fragebogen – beantwortet von Michael Roth, Duisburg

Interview: Alexander Bentheim und Ralf Ruhl
Redaktion: Alexander Bentheim
Fotos: privat
Michael, was waren deine biografischen Zugänge zu Jungen-, Männer- und Väterthemen? Welche Themen waren damals und heute zentral in deiner Beschäftigung mit Jungen und Männern? Und wie hat sich dein Engagement entwickelt, ggf. verändert?
Als 15-jähriger Georgspfadfinder übernahm ich eine Juffi-Gruppe (Juffis werden die Jungpfadfinder genannt) mit ca. acht Jungen im Alter 10-12/13 Jahren; es war die Zeit der 1968er. Mit 16 wurde ich – als Nachfolger meines 5 Jahre älteren Bruders – zum sog. Stammesleiter einer (Vor)Ortsgruppe gewählt, den Posten hatte ich ca. fünf Jahre lang inne. Und mit 17 leitete ich ein Lager in der Eifel mit ca. 18 Jungen.
Mein Vater – 43 Jahre alt, als ich 1952 als jüngstes von drei Kindern geboren wurde (es gab neben dem Bruder noch eine knapp drei Jahre ältere Schwester) – war Modellbaumeister und hatte eine Schreinerei hinter unserem Wohnhaus. Nach meinem Bruder ging auch ich dort in die Lehre, weil es »so einfach« war und ich daher auch viel Zeit bei meinen Pfadfinderfreunden verbringen konnte.
Mein Vater war von ca. 1927 bis 1936 in der katholischen Jugend aktiv und erzählte uns Kindern einiges aus dieser Zeit, von seiner Jugendgruppe, den gemeinsamen Unternehmungen, Radtouren, Wanderungen, Zeltlagern und von Jugendkaplänen, mit denen sie Tischgottesdienste – Eucharistiefeiern im kleinen Kreis – feierten. Das hat uns Kinder geprägt. Ich übernahm die progressive, kritische Einstellung zur katholischen Kirche, war immer bemüht, das für die Menschen und für die Gemeinschaft Wichtige aus den »Lehren« der Kirche umzusetzen. Ich hatte das Glück, immer wieder Priester zu erleben, die auch offener dachten. Meine eigene junge Familie kehrte dann mit einigen anderen ehemaligen Pfadfindern der konservativen Ortsgemeinde den Rücken, denn wir fanden Gefallen an der kleinen Gemeinde in der Innenstadt, die von einem weltoffenen Karmeliterpater geleitet wurde. Über 20 Jahre lang war ich dort im Gemeinderat leitend tätig und konnte sogar meine Vorstellung von einer Gemeinde ohne amtliche priesterliche Leitung umsetzen.
Das Gemeinschaftliche, das gemeinsame Tun in der Gruppe, hatte mich auch angesteckt; seit der frühen Jugend war ich mit der »Arbeit« mit Jungen und Jugendlichen im Sinne einer steten Organisation des gemeinschaftlichen Zusammenseins »betraut«. Ich habe dann auch Leiterkurse besucht, mein Wissen mit etwas Pädagogik und Psychologie angereichert, und bis zum Alter von ca. 26 Jahren war ich in verschiedenen Stadtleitungen der DPSG-Jugendarbeit aktiv. Während meiner Zeit als Leiter veränderte sich die DPSG als Organisation stark: Aus dem Verband der »Waldläufer« wurde ein moderner Jugendverband, der gemeinschaftlich und sozial engagiert ist, und dessen selbständige Ortsgruppen den katholischen Kirchengemeinden nahe, aber nicht von ihnen abhängig sind. Noch einige Jahre später wurde aus dem Jungenverband ein koedukativer Verband.
Gab es für dich nachhaltige gesellschaftliche Ereignisse – auch für den Kontext deiner Arbeit und für deine privaten und beruflichen Beziehungen?
Das Zusammensein von Jungen/Männern und Mädchen/Frauen war für mich eine nachhaltige Erfahrung, ich lernte Gleichberechtigung im Miteinander. Das half mir im weiteren Leben: bei der Organisation von Aktionen z.B. im Umweltschutz, für den damals sog. »Dritte Welt«-Gedanken, hinsichtlich von fairem Handel oder für benachteiligte Menschen. Aber auch als Verliebter, als Ehemann, als Vater eines Sohnes und zweier Töchter sowie als Lehrmeister von drei Frauen und 27 Männern spielte die Erfahrung und Vermittlung von Gleichberechtigung eine wichtige Rolle.
Besonders das demokratische, gemeinschaftliche Handeln ist eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Dabei war das Miteinander im Pfadfinderverband ein wichtiges Erfahrungsfeld, in dem ich auch meine kritische Haltung zu »Obrigkeiten«, besonders zu autoritären wie der katholischen Kirche, entwickelt habe.
Was hat die Männer/* ausgemacht, mit denen du gerne zusammengearbeitet oder Zeit verbracht hast?
Zum 40sten Geburtstag schenkte mir ein Bekannter ein Männerbuch – den Titel weiß ich nicht mehr, aber das Lesen über Freiräume für Männer in der Ehe und über Männergruppen weckte eine neue Seite in mir. Ich war durch die vorhergehende Beratungsarbeit, mit der wir aus unserer ersten Ehekrise herausfanden, sensibilisiert. Zum 41sten im Kreis der Männergäste habe ich eine Männergruppe im westlichen Ruhrgebiet gegründet. Und bei den Gruppentreffen habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass alleine schon das Ansprechen von Gefühlen, Problemen, Situationen oft der Ansatz für eine Lösung sein kann, dass die Sichtweisen und Reaktionen der anderen Männer etwas in mir und den Männern in Bewegung brachte.
Mit 47 Jahren – 1999 war das – habe ich an einem Männerseminar der evangelischen Kirche mit Richard Rohr teilgenommen; mein erster Kontakt zu »fremden« Männern und meine ersten Gespräche mit schwulen Männern.
2000 bin ich als Teilnehmer zu den bundesweiten Männertreffen gekommen, was in gewisser Weise spät war. Ich habe dort und in den späteren Männertreffen die Vielfalt der Männer, die sehr unterschiedlichen Bedingungen ihres Heranwachsens, ihrer jeweiligen Familiensituationen und von den Beziehungen der Männer zu ihren Vätern erfahren.
Das Jahr 2000 sollte auch mein Sabbatjahr werden; mit einem Mann aus der Männergruppe bin ich auf den »Spuren der Kaiser« (alter Krönungsweg) nach Rom geradelt. Drei Wochen enges Männerzusammenleben führte zu Erfahrungen, die ich schätzen gelernt habe: Vertrauen auf den Anderen, faire Auseinandersetzungen, Respekt, Nähe, Gemeinschaft.
Rückblickend denke ich: ohne die Erfahrungen mit Gruppen und Männern hätte ich keinen Freunde*innenkreis. Auch wären mir einige Dinge nicht gelungen: der Zusammenhalt in der Ehe mit der Entstehung einer 15-köpfigen »Sippe«, die Ausbildung von meist schon älteren bzw. volljährigen Azubis, die Gründung eines »Dritte Welt Ladens« sowie der langwierige Prozess der Umgestaltung der Gemeinde zu einer Gemeinschaft mit selbstbestimmender Leitung.
Hast du ein Lebensmotto?
Probieren geht über studieren – oder: Versuch macht klug.
Eigenschaften, die dich in deiner Arbeit und/oder Beziehungen zu anderen ausmachen?
Machen, Zuverlässigkeit, 80% Toleranz, Treue.
Wo liegen für dich die hartnäckigsten Widerstände gegen dein Verständnis vom Umgang mit Jungen-, Männer- und Väterthemen?
Im Orga-Team zur Vorbereitung der Männertreffen habe ich Erfahrungen mit dem Ausdiskutieren von Argumenten über die Konsensfindung bis hin zu einstimmigen Entscheidungen gemacht. Ich denke, nach dieser Erfahrung, dass in unserer Gesellschaft heute zu oft fehlt: andere zur wirklichen AUS-Sprache kommen zu lassen, einander zuhören, nachfragen, Gemeinsamkeiten und Verbindendes suchen – was bedeutet, sich auch immer wieder auf andere Menschen einzulassen und ihr »Sosein« zu respektieren.
Die immer noch vorherrschende männliche Macht in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft beeinflusst unser Denken. Ich erlebe jetzt im Alter, dass sich bei den Männern eine Teilung auftut: die einen werden sensibler, weicher, einfühlsamer, andere bleiben »Indianer«, »Männer wie wir«, hinter ihren uralten Mauern.
Da unser Leben auf Gemeinschaft, auch Partnerschaft angelegt ist, habe ich meiner Frau und Partnerin viel in meiner Reifung zu verdanken. Sie hat mir immer wieder mein Verhalten gespiegelt. Oft habe ich das zunächst »hart« empfunden, aber in der Reflexion später annehmen können – zumal mich meine Partnerin besonders in meinen schweren Zeiten unterstützt hat.
Welches Projekt würdest du gerne noch umsetzen, wenn du die Möglichkeiten dazu hättest? Und was möchtest du gegen Ende deines Lebens erreicht haben?
Im letzten Lebensdrittel erfolgt für mich die »Kür«: nachdem im ersten Drittel das Lernen dran war, im zweiten Drittel die Arbeit, die Familie und das Wirtschaften (und meine Frau trug die Hauptlasten in der Familie einschließlich der Kinder), will ich nun mehr mittragen, auch mehr mitgestalten an einer friedlichen Welt. Nach 45 Ehejahren mit meiner Frau Ingrid sind unsere drei Kinder und sieben Enkelkinder zugleich Baustellen und Genuss in dieser Welt. Sie haben unsere volle Unterstützung, solange wir können und sie uns anfordern. Das heißt für mich »allzeit bereit« und »look to the kids« – alte Pfadfinder-Sätze bleiben aktuell.
Und in einem Teil der dann noch verbleibenden »freien Zeit« sorge ich als Mitarbeiter im ADFC mit für ein fahrradfreundliches und sicheres Duisburg – mein Beitrag zum besseren Klima und zur Mobilität der Nachkommen.
ps. Mittlerweile weiß ich wieder, welches Männerbuch mir geschenkt wurde – es war Sam Keen’s »Feuer im Bauch« …
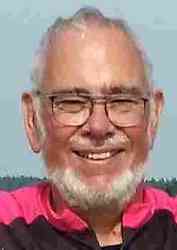
:: Michael Roth, geb. 1952 in Duisburg und immer dort geblieben, geprägt vom Dreiereck Pott, Niederrhein und dem Bergischem. Nach Realschule Modellbauer-Handwerk (Gießerei) erlernt. Als Tischlermeister die Werkstatt meines Vaters übernommen und über 30 Tischler:innen ausgebildet. Jungen und Männerarbeit in der DPSG. Männergruppe gegründet, Teilnehmer an einigen Männertreffen. Über 20 Jahre Vorstand im Gemeinderat einer überörtlichen katholischen Gemeinde.